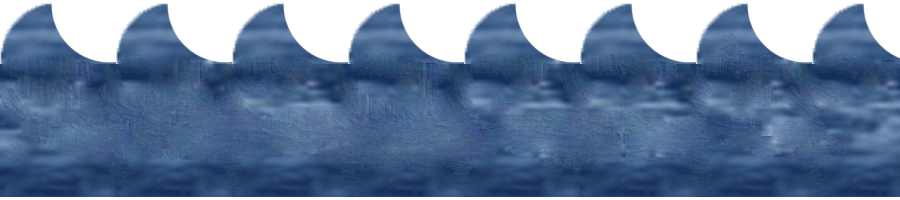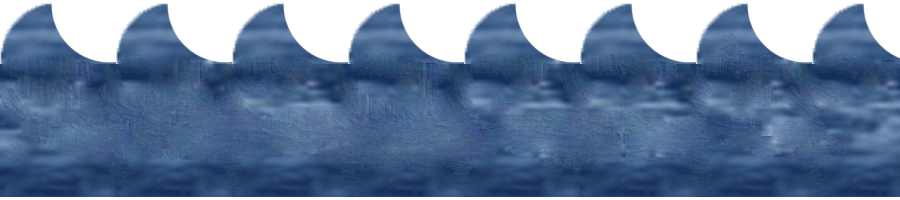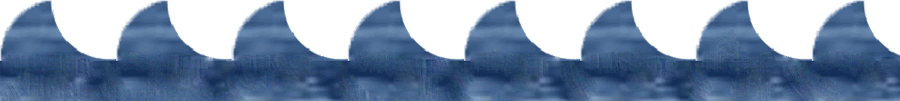
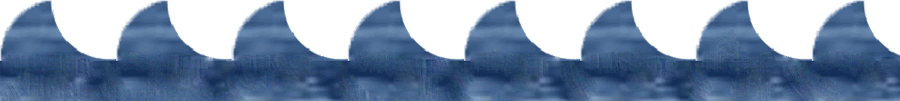
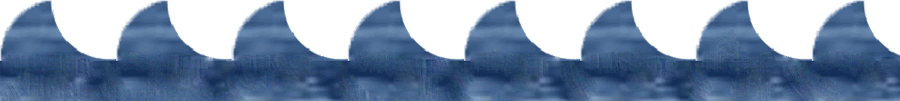
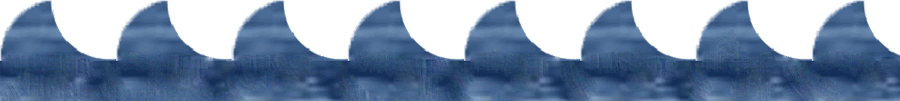


Drücke einfach auf die blaue Schrift oder in die Bilder!
 Die Meeresschildkröten
Die MeeresschildkrötenMeeresschildkröten sind vor Millionen Jahren vom Land zurÜck ins Wasser gewandert. Sie haben sich völlig an das Leben im Meer angepaßt. Es gibt sieben Arten:
Meeresschildkröten bewohnen alle tropischen und subtropischen Meeresgebiete und verbringen bis auf die Eiablage ihr gesamtes Leben im Wasser. Die ersten Meeresschildkröten haben sich wahrscheinlich vor etwa 200 Millionen Jahren aus landlebenden Schildkröten entwickelt. Meeresschildkröten ernähren sich von Tintenfischen, Krebsen und Quallen, die sie bei ihren langen Tauchgängen jagen. Die Meeresschildkröten legen jährlich weite Strecken auf ihren Wanderungen durch die Meere zurück. Die Wandereungen der Meeresschildkröten werfen noch viele Rätsel auf und werden daher von Forschern der ganzen Welt beobachtet.
Die Paarung der Meeresschildkröten findet auf dem offenen Meer statt. Danach suchen die Weibchen zielstrebig ihren Geburtsstrand auf und legen dort ihre Eier ab. Bei der Eiablage ziehen sich die weiblichen Tiere in der Nacht mit ihren Flossen über den Sandstrand und vergraben die Eier in einer etwa 30–50 cm tiefe Grube. Nachdem die Eier gelegt sind, macht sich die Schildkröte auf den Weg zurück ins Meer. In der Regel finden sich innerhalb weniger Nächte alle Weibchen eines Strandes ein und legen ihre Eier, entsprechend gleichzeitig können dann auch die Jungtiere schlüpfen, vorausgesetzt, ihr Gelege wurde nicht Opfer eines Nesträubers (beispielsweise Stinktiere, Waschbären oder der Mensch). Die Sonne brütet die Eier aus. Bei Temperaturen über 29,9 Grad entwickeln sich Weibchen. Bei niedrigeren, Männchen. Das gleichzeitige Eiablegen und Schlüpfen sorgt dafür, dass die Nesträuber gewöhnlich satt sind, bevor allzu großer Schaden angerichtet ist, wodurch mehr Jungtiere überleben. Weitere Feinde warten auf dem Weg der frisch geschlüpften Jungtiere zum Meer, vor allem Möwen und Rabenvögel. Eine weitere natürliche Bedrohung für die Nester sind heftige Stürme, die in den tropischen Gegenden oft ganze Strände verwüsten. Der Mensch bedroht sie ungewollt durch Straßen, Städte und andere Lichtquellen: Die gerade geschlüpften Tiere orientieren sich natürlicherweise am Mondlicht. Auf ihrem Weg ins Meer werden sie durch diese Lichtquellen irritiert. Sie folgen dem falschen Weg und müssen sterben, wenn sie nicht rechtzeitig von Tierschützern eingesammelt- und ins Meer entlassen werden.
| Zu den Meeresschildkröten gehören auch die Lederschildkröten, die größten Schildkröten die es gibt. Sie werden bis zu 2,5m lang, sind hervorragende Taucher (tauchen bis 1200m Tiefe) und haben an den Paddeln keine Krallen. Mit den anderen Meeresschildkröten sind die Lederschildkkröten nicht näher verwandt. |  |
 Meeresschildkröten in Gefahr
Meeresschildkröten in GefahrAlle Meeresschildkröten sind in ihrem Bestand vom Aussterben bedroht. Die Bedrohung geht dabei ausschließlich vom Menschen aus, der sie aufgrund ihres Fleisches, der Eier und ihrer Panzer seit Jahrhunderten jagt. Besonders in den asiatischen Ländern ist das Fleisch sehr begehrt und auch Handelsverbote, empfindliche Strafen und hohe Schwarzmarktpreise schränken den Handel kaum ein. Schildkrötenleder und das Schildpatt der Panzer stehen ebenfalls hoch im Kurs, vor allem in Japan, wo sie als Glücksbringer gelten. Taucher bedrohen mitunter auch die Meeresschildkröte, denn wird eine Schildkröte auf ihrem Weg an die Wasseroberfläche zum Luftholen gestört, zum Beispiel durch Berührung, taucht diese wieder ab und erstickt.
Die Verschmutzung ganzer Meeresregionen und Niststrände entzieht vielen Meeresschildkröten ihre Lebensgrundlage .
Moderne Fischfangmethoden stellen eine zusätzliche massive Bedrohung dar, da Tausenden von
Meeresschildkröten als Beifang in einem Krabben- oder Fischnetz sterben.
Alle Meeresschildkröten stehen offiziell unter Artenschutz durch das Washingtoner Artenschutzabkommen. Der Handel mit
Schildkrötenprodukten ist verboten und sie dürfen nicht gefangen und getötet werden. All diese Maßnahmen wirken jedoch nur
schleppend. International versuchen Tierschützer und Organisationen den Schutz der Tiere durchzusetzen, indem sie Brutgebiete
einzäunen und bewachen oder Zuchtstationen aufbauen.
 Sumpfschildkröten
SumpfschildkrötenDie Europäische Sumpfschildkröte ist eine kleine bis mittelgroße, überwiegend im Wasser lebende Schildkröte. Sie ist die einzige Schildkrötenart, die in Mitteleuropa (auch Österreich) natürlich vorkommt. Sie besitzt ein ausgedehntes Verbreitungsgebiet von Nordafrika im Südwesten bis an den Aralsee im Nordosten.
Die Europäische Sumpfschildkröte ernährt sich vor allem von Schnecken, Krebstieren, Insektenlarven und anderen wirbellosen Tieren. Aber auch Kaulquappen, tote Fische oder Aas werden gerne angenommen. Die europäische Sumpfschildkröte ist kein reiner Fleischfresser, sondern verspeist auch manchmal Wasserpflanzen.
In Österreich findet man sie z.B. in den Donauauen oberhalb Wiens. Leider ist ihr bestand sehr gefährdet. Einerseits hat sie immer weniger Lebensraum zur Verfügung (etwa durch Trockenlegung von Sümpfen, andererseits stellen auch ausgesetzte Schildkröten eine große Bedrohung dar, z.B. die Rotwangenschildkröten, die die heimischen Tiere verdrängrn.
 Weitere Reptilien in Süß- und Salzwasser
Weitere Reptilien in Süß- und SalzwasserManchchmal dreht die Natur den Spieß wieder um: Neben den Meeresschildkröten sind auch andere landbewohnende Reptilien wieder zurück ins Wasser gewandert. Andere, wie die Krokodile waren seit jeher an die Nähe von Wasser gebunden:
 |
Neben den Meeresschildkröten sind die Seeschlangen die bekanntesten der heute im Meer lebenden Reptilien. Sie gehören zu den
Schlangen und werden innerhalb dieser in die Verwandtschaft der Giftnattern eingeordnet. Es gibt etwa 56 Arten. Fast alle Seeschlangen sind lebendgebärend und bekommen ihre Jungen im Meer, wo sie ihr gesamtes Leben verbringen. Nur Plattschwanz-Arten verlassen das Meer und legen ihre Eier an Land ab, wo sie auch außerhalb der Paarungs- und Eiablagezeit Ruhepausen einlegen. Zur Fortpflanzungszeit besiedeln diese Schlangen in sehr großen Zahlen verschiedene Inseln, vor allem auf den Philippinen. Allgemein sind sonnen- und wärmesuchende Seeschlangen oft auch auf See in großen Gruppen an der Wasseroberfläche anzutreffen: Außer dem Menschen haben die Seeschlangen aufgrund ihres sehr wirksamen Giftes kaum wirkliche Fressfeinde. Möglicherweise werden sie gelegentlich von Haien oder Walen gefressen. Auch in heimischen Seen ist es nicht verwunderlich, eine Schlange anzutreffen: Die für Mensschen harmlosen Ringel- oder auch Würfelnattern sind gute Schwimmer und Taucher. |
 |
Die Ordnung der Krokodile umfasst zusammen mit den Vögeln die letzten Überlebenden der Archosaurier, zu denen auch die
ausgestorbenen Dinosaurier gehörten. Krokodile und Vögel sind also verwandte Tiergruppen.
Krokodile haben einen Knochenpanzer unter der Haut und werden daher auch als Panzerechsen bezeichnet. Alle heute lebenden Krokodile leben in Flüssen und Seen der Tropen und Subtropen, nur das Salzwasserkrokodil kann auch im Meer leben und kommt häufig an den Küsten verschiedener Inseln vor. Als Anpassung an ihren Lebensraum können die Tiere sehr gut schwimmen und tarnen sich im Wasser, indem sie vollständig bis auf Augen und Nasenlöcher untertauchen. Die Vorfahren der Krokodile wanderten vor über 200 Millionen Jahren vom Land zurück ins Wasser. Aller heute lebenden Krokodile sind ans Wasser gebunden und leben räuberisch von Fischen oder anderen Beutetieren. Krokodile sind trotz ihres "wilden" Aussehens oft liebevolle Mütter, die ihre Jungen beschützen und bewachen. |
 |
Meeresechsen, die auf den Galápagosinseln mit einer einzigen Art vertreten sind, sind friedliche Pflanzenfresser und eine junge Art. Die letzten echten Meeresechsen sind nämlich bereits mit den Dinosauriern zum Ende der Kreidezeit von unserem Planeten verschwunden. Vor vier Millionen Jahren erhoben sich die Schildvulkane der Galápagos-Inseln über die Wasseroberfläche. Landbewohnenden Reptilien von der Küste Südamerikas aus erreichten die Inseln nach einem Wasserweg von über 1000 Kilometern wohl mehr tot als lebendig.Dennoch gelang es ihnen, sich an den extremen Standort anzupassen. Wasser- und Nahrungsmangel an Land führten die ehemaligen Landbewohner direkt ins Meer. Sie entwickelten die Fähigkeit zu tauchen , bis zu 15 Minuten kann eine Meerechse unter Wasser bleiben, und weidenseither die algenbewachsenen Lavaformationen ab. Lange Krallen an kräftigen Zehen helfen ihnen, sich auf ihren Unterwasser-Weidegründen festzuhalten. Nach jedem Tauchgang nehmen die wechselwarmen Reptilien ein ausgiebiges Sonnenbad auf den warmen Lavafelsen, um ihre "Betriebstemperatur" von 37 Grad Celsius wieder zu erreichen |
 Amphibien
AmphibienAmphibien sind stärker ans Wasser gebunden als Reptilien. Auch Arten die eigentlich an Land wohnen, müssen zur Eiablage zurück zu ihren Geburtstümpel, wo sich dann die Kaulquappen entwickeln. Die Natur ausgetrickst hat da nur der Bergsalamander; Bergsalamander bringen lebende Junge zur Welt und sind auf eine hohe Luftfeuchtigkeit angewiesen. Daher kann man Bergsalamander besonders gut bei einsetzendem Regen oder Nieselregen beobachten, wenn ie in Scharen aus ihren Verstecken kommen.
Fast alle Amphibien-Arten sind stak bedroht. Einerseits gibt es nur noch wenige Tümpel, andererseits warten auf wandernde Exemplare wie etwa den Erdkröten auf ihren Wanderungen zum Geburtsteich viele Gefahren. Viele Tierschützer bewachen daher die Amphibien auf ihrern Laichwanderungen und retten so vielen Tieren das Leben.
Froschlurche sind die bei weitem artenreichste der drei Ordnungen aus der Wirbeltierklasse der Amphibien. Zu den Froschlurchen zählen unter anderem die heimischen Frösche, Kröten und Unken. Aber auch die knallbunten Pfeilgiftfrösche aus den Regenwäldern Südamerikas oder die roten Erdbeerfröschchen, die ihre Kaulquappen auf dem Rücken tragend in eine mit Wasser gefüllte Pflanze (Bromelie) in den Baumwipfeln der riesigen Bäume bringen, gehören zu dieser Tier-Ordnung.Die anderen Ordnungen der Amphibien sind die Schwanzlurche und die Schleichenlurche oder Blindwühlen
Unten findet ihr eine Auflistung wichtiger heimischer Amphibien:
 |
Bei den Echten Fröschen handelt es sich um mittelgroße bis große, kräftige Froschlurche mit langen Hinterbeinen, die sie zu weiten Sprüngen befähigen. Die Haut ist glatter und feuchter als bei den Kröten. Dafür ziehen sich entlang des Rückens zwei Drüsenleisten, Die Schnauze ist stärker zugespitzt; das Trommelfell ist meist groß und deutlich sichtbar. Die ovalen Pupillen sind waagerecht gestellt. Zwischen den Zehen der Hinterfüße befinden sich in der Regel gut ausgebildete Schwimmhäute. Die Männchen der Echten Frösche besitzen häufig Schallblasen.Die Der Laich wird nach der Paarung als Klumpen ins Wasser abgegeben. | ||||||||||||
 |
Die Kröten bilden eine Familie innerhalb der Ordnung der Froschlurche. Weltweit gibt es mehr als 500 Arten.
Sie haben eine "warzige", drüsenreiche Haut und eher kurze Hinterbeine. Bei den meisten Arten durchlaufen die
Nachkommen eine Kaulquappen-Phase im Wasser, während sich bei anderen die Jungen direkt innerhalb der Eier entwickeln- dann schlüpfen
fertige Jungkröten aus den Eiern. 2 Gattung sind sogar lebendgebärend:Die Eier werden im Mutterleib ausgebrütet. Die Echten Kröten sind mehrheitlich an Land lebende, dämmerungs- und nachtaktive Tiere, die sich tagsüber versteckt halten. Viele Kröten müssen ihre Fortpflanzungsgewässer immer wieder aufsuchen, während andere herumwandern und passende Kleingewässer spontan besiedeln(beispielsweise die Kreuzkröte). |
||||||||||||
 |
Unken-füher nannte man sie auch Feuerkröten, sind eine Gattung der Froschlurche. Sie gelten als urtümliche Froschlurche und glieedern sich in 5-8 Arten. Je nach Literatur werden fünf bis acht Arten, die man von Europa bis nach Ostasien findet. Unken sind sehr kleine, warzige, krötenartige Amphibien mit abgeflachten Körpern, von denen die meisten Arten nur etwa vier bis fünf Zentimeter lang werden. Auf ihrer Unterseite tragen sie auffällig bunte Warn-Farben als Zeichnungsmuster, die potenzielle Fressfeinde auf ihre Hautgifte aufmerksam machen sollen. Die Oberseite der Tiere ist meist graue bis braun gefärbt. auf, durch die sie auf schlammigem Boden gut getarnt sind. Die Haut ist mit sehr vielen drüsenhaltigen Warzen bedeckt, die bei den Gelbbauchunken zudem hornige Spitzen tragen. Alle Arten der Unken bevorzugen stehende Gewässer, die sie anders als viele andere Froschlurche nur ungern über größere Distanzen oder längerfristig verlassen. Die Rotbauchunke lebt dabei vor allem an Stillgewässern wie kleineren Altarmen von Flüssen oder ruhigen Feldweihern und vor allem an Überflutungstümpeln in Auen. Die Gelbbauchunke findet man dagegen nur in höher gelegenen Gebieten, insbesondere Mittelgebirgsregionen, wo sie sich vor allem in Klein- und Kleinstgewässern wie Tümpeln, Lehmpfützen oder wassergefüllten Fahrrinnen aufhält, oft auch in der Nähe von kleinen Bergbächen. Die Gefährdung der europäischen Unkenarten geht, wie bei den meisten Amphibien, mit dem Rückgang der Gewässer und damit ihrer Lebensräume einher. Sehr viele Stillgewässer werden im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung sowie anderer Flächentrockenlegungen sowie bei der Begradigung und dem Ausbau von Bach- und Flussläufen (weniger Überschwemmungsflächen) und bei der Absenkung des Grundwassers zerstört. Dies betrifft gerade auch die Klein- und Kleinstgewässer, in denen Unken heimisch sind. Hinzu kommt eine zunehmende Verschmutzung der Gewässer durch Pestizide und Dünger. Die von Gelbbauchunken bevorzugten Lebensräume müssen ständig durch Nutzung oder Pflege offengehalten werden, da sie sonst sehr rasch verbuschen. Neue Biotope können in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft dagegen kaum mehr auf natürliche Weise entstehen. Meist nur noch in Bodenabbaugruben und auf lehmigen Waldwegen finden sich geeignete Bedingungen. Um die Unken zu schützen sollten Gebiete, in denen die Tiere vorkommen, unter Schutz gestellt werden. Dazu gehört vor allem auch die Neuanlage und Pflege von Teichen und Tümpeln, der Erhalt von Grünflächen sowie der Rückbau von Entwässerungsanlagen. |
||||||||||||
 |
Bei den Salamandern handelt sich um langgestreckte, geschwänzte Amphibien mit nackter Haut. Zur Gruppe gehören ständig
im Wasser lebende Arten wie beispielsweise der Japanische Riesensalamander oder auch ständig an Land lebende Arten wie etwa der
Feuersalamander.
Zu dn Salamandern gehören neben dem Feuersalamander und dem Bergsalamander auch alle heimischen Molche. Salamander sind bezüglich ihrer Regenerationsfähigkeit bemerkenswerte Lebewesen. Verlieren diese Tiere einen Körperteil, wächst er in mehr oder minder verkürzter Form wieder nach. Berg- und Feuersalamander verbringen ihr Leben an Land. Während Feuersalamander zum Laichen noch Gewässer benötigen, bringen Bergsalamander lebende Junge zur Welt. Diese Amphibien sind nicht an Gewässer gebunden, brauchen aber eine hohe Luftfeuchtigkeit, um nicht auszutrocknen. |
||||||||||||
 |
Als Molche werden verschiedene, nicht unbedingt näher verwandte Amphibien-Arten aus unterschiedlichen Familien der Ordnung
Schwanzlurche bezeichnet. Sie ähneln sich dadurch, dass sie als erwachsene Tiere zumindest phasenweise (zur Fortpflanzung)
im Wasser leben und dazu Flossensäume an den Schwanzober- und -unterseiten entwickeln. Bei uns heimische Molch Arten sind Kammolch, Bergmolch und Teichmolch. Steckbrief des bei uns häufigen Kammmolchs:
|